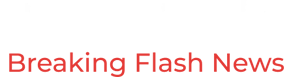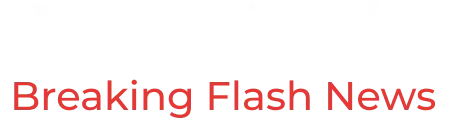In «Knife» verarbeitet Salman Rushdie den lebensgefährlichen ...
Fünfzehn Mal stach der Attentäter auf Salman Rushdie ein. Nun schreibt der Schriftsteller über den Mordversuch

Am 12. August 2022 überlebte Salman Rushdie nur ganz knapp den Angriff eines Messerstechers. In «Knife» erinnert er sich an den schicksalshaften Tag.
Thomas Lohnes / Getty
Siebenundzwanzig Sekunden dauerte am 12. August 2022 die Messerattacke auf Salman Rushdie. Fünfzehn Mal stach der Attentäter auf den Schriftsteller ein. Er traf ihn im rechten Auge, am Hals, in der Brust, im Bauch, in der linken Hand. Schnitte überall, tiefe Stichwunden, durchtrennte Sehnen und Nerven. Die Leber war verletzt. Rushdie lag in einer Blutlache, ehe ein Freund mit dem Mut der Verzweiflung dazwischenging und den Attentäter von seinem Opfer wegreissen konnte.
In siebenundzwanzig Sekunden könnte ein religiös gesinnter Mensch, so schreibt Salman Rushdie in seinem soeben erschienenen Buch «Knife. Gedanken nach einem Mordversuch», das Vaterunser beten. Oder er selber könnte sein liebstes Shakespeare-Sonett laut lesen. Rushdie hätte auch schreiben können: Siebenundzwanzig Sekunden reichten nicht, ihn zu ermorden.
Es grenzte allerdings fast an ein Wunder, dass Salman Rushdie lebend im Krankenhaus ankam. Und es war alles andere als selbstverständlich, dass er die folgenden langen Stunden überlebte, als ihn mehrere Chirurgen notoperierten. Selbst sie zweifelten, ob sie ihn würden retten können.
Einer der Ärzte sollte später Rushdies Überleben lakonisch einem Zufall zuschreiben: «Ihr grösstes Glück war, dass der Mann, der Sie angriff, keine Ahnung davon hat, wie man einen Menschen mit dem Messer umbringt.»
Der Attentäter hatte freie BahnSalman Rushdie hätte am Morgen jenes 12. August 2022 in der Kleinstadt Chautauqua nordöstlich von New York einen Vortrag halten sollen. Gerade hatte er die paar Schritte zur Bühne im Amphitheater des örtlichen Kulturzentrums gemacht, als er aus dem rechten Augenwinkel – «das Letzte, was mein rechtes Auge je sehen würde» – einen Mann in Schwarz auf sich zurennen sah.
Dreiunddreissig Jahre waren seit der gegen ihn verhängten Fatwa vergangen. Längst trat er ohne Personenschutz auf, und auch auf dem Campus war kein Sicherheitspersonal anwesend. Der Angreifer, ein vierundzwanzigjähriger, in Amerika geborener Mann mit libanesischen Wurzeln, der von Rushdies Werken nicht mehr als ein paar Zeilen gelesen hatte, konnte sich ungehindert auf sein Opfer stürzen.
Rushdie sah nichts als diese schwarze Gestalt, aber er ahnte in den wenigen Sekunden, dass einer gekommen war, das Todesurteil der iranischen Mullahs zu vollstrecken. Warum er sich nicht gewehrt habe, fragt er sich und gesteht, dass er sich an manchen Tagen sogar dafür schäme, nicht wenigstens die Flucht ergriffen zu haben. Gewalt zerschlage das Bild der Normalität, schreibt Rushdie. «Plötzlich kennt man die Regeln nicht mehr – weiss nicht, was man sagen, wie man sich benehmen, welche Wahl man treffen soll.»
Was dann genau geschah, vermag Rushdie heute nur noch als eine Collage von Bildern zusammenzusetzen: der Messerhieb ins Auge, die Schläge ins Gesicht, wie er schliesslich nach hinten fiel. An Schmerzen erinnert er sich nicht. Man erzählte ihm später, dass er geschrien habe vor Schmerz. Immer wieder habe er gefragt, warum ihm die Hand so weh tue. Aber er hörte, wie jemand befahl, seinen Anzug aufzuschneiden, um an die Verletzungen heranzukommen. Und er erinnert sich daran, was ihm in jenem Augenblick durch den Kopf ging: «Doch nicht meinen schönen Ralph-Lauren-Anzug.»
Ausserdem wollte er den Leuten um sich herum unbedingt etwas sagen: «In der Tasche sind meine Kreditkarten. Und in der anderen Tasche ist der Hausschlüssel.» Rückblickend erkennt Rushdie darin Zeichen seines Überlebenswillens. Er habe selbst in dieser aussichtslosen Lage durchaus vorgehabt, Schlüssel und Karten in Zukunft wieder zu gebrauchen. «‹Lebe!›, flüsterte es in mir. ‹Lebe!›»
«A.» für Attentäter, Angreifer, ArschlochSalman Rushdies «Gedanken nach einem Mordversuch» sind ein grimmiger und auch schmerzhafter Versuch, die siebenundzwanzig Sekunden der Messerattacke erzählerisch zurückzugewinnen. Die weitgehend ausgelöschte Erinnerung daran wiederherzustellen und damit jene Selbstbestimmung über die eigene Geschichte und die eigenen Geschicke zu erlangen, die ihm nicht nur vom Attentäter geraubt worden waren. Denn auch die Ärzte hatten ihm, so beschreibt es Rushdie eindringlich, während der achtzehn Tage auf der Intensivstation und der nachfolgenden Rekonvaleszenz notgedrungen eine lange Folge von Demütigungen zugefügt, indem ihm die Kontrolle über den eigenen Körper entzogen worden war.
Zwar stehen der Mordversuch und die unmittelbaren Folgen im Zentrum dieses Berichts, aber Rushdie holt weit aus. Er geht etwa zurück zu seinem Vater und dessen Alkoholexzessen, was ihr Verhältnis und Rushdies Sinn für das Familienleben massiv und lange beeinträchtigt hatte. Oder er erzählt von dem «coup de foudre», als er 2017 der Dichterin Rachel Eliza Griffiths begegnet war. Es muss für beide Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Rushdie war in dem Augenblick so sehr geblendet vom Lachen der dreissig Jahre jüngeren Frau, dass er, kaum waren sie ins Gespräch gekommen, gegen eine Glastüre rannte und blutend zu Boden stürzte.
Heute kommt ihm die Szene wie ein Slapstick vor, der alles Spätere sinnbildlich vorwegnahm: Eliza brachte ihn nach Hause und blieb bis zum frühen Morgen bei ihm. Nach dem Messerangriff war sie es, die ihn durch das lange Martyrium der Rekonvaleszenz begleitete und nicht von seiner Seite wich.
Auch der Attentäter kommt ins Bild. Rushdie nennt ihn nur «A.» für Attentäter, Angreifer, Arschloch. Rasch verwirft er den Gedanken, ihn im Gefängnis zu besuchen. Er ahnt, dass sie sich nichts zu sagen haben, und entscheidet sich für jenes Mittel, das er beherrscht: die Phantasie. Er führt mit ihm ein langes, imaginäres Zwiegespräch, bis er dessen überdrüssig wird.
Es sind alles tastende Versuche, ins Leben zurückzufinden oder vielmehr: in ein neues, in ein geschenktes Leben zu finden. Rushdie spricht von einer zweiten Chance, er hätte auch sagen können: eine zweite Geburt. «Was fängt man mit so einer zweiten Chance an?», fragt er sich. Spontan schreibt er hin: «Liebe und Arbeit». Doch alsbald merkt er, dass sich dieses zweite Leben nicht darin erschöpfen kann. Es gilt auch, hält er nun fest, «an vielen Fronten einen Krieg zu kämpfen». Gegen die Bigotterie in der Welt zum Beispiel oder gegen den Zynismus der Macht.
«Ich bin ein schräger Vogel»Das neue Leben wird das alte sein: Der kämpferische und unbeugsame Salman Rushdie kehrt zurück. Und auch jener Rushdie kommt wieder, der mit dem Humor über jene Gabe verfügt, die allen Attentätern und Despoten dieser Welt fehle, wie er sagt. «Wer bin ich?», lautet eine Frage gegen Ende von «Knife». Und man verzeiht Rushdie die kleine Koketterie, die er sich nun gestattet: «Ich bin ein schräger Vogel, für die Missgeschicke in meinem Leben berühmter als für meine Bücher.»
Das stimmt und stimmt zugleich nicht. Seine Werke bleiben, aber niemand kann sie lesen, ohne an die Fatwa zu denken. Und seit dem Mordversuch geht das noch weniger. Selbst Rushdie kommt nicht umhin, wenn er nun in seinen Büchern deutliche Vorahnungen dieser Messerattacke liest.
Im September 2023 kehrt er mit Eliza an den Schauplatz in Chautauqua zurück. Nun zeigt er ihr, wo er die Bühne betrat, wo der Attentäter auf ihn einstach und wo er schliesslich fiel. Auf dem Weg vom Flughafen machen sie Halt vor dem Gefängnis, in dem der Attentäter inhaftiert ist. Rushdie will den Ort sehen. Er muss beide Orte sehen, um etwas abschliessen zu können. So, wie er sich diese Geschichte vom Leib schreiben muss, um das Überleben zu überleben. Rushdie ist zurück, vielleicht etwas melancholischer, aber mutig und witzig wie je.
Salman Rushdie: Knife. Gedanken nach einem Mordversuch. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Penguin-Verlag, München 2024. 255 S., Fr. 37.90.