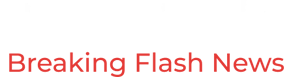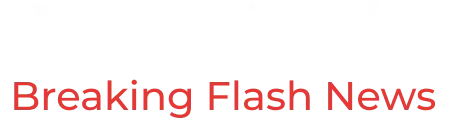Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Salman Rushdie ...
Literatur Selten wird ein Schrifsteller dafür ausgezeichnet, einfach nur am Leben zu sein. Mit Salman Rushdie erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ein großartiger Erzähler, der unermüdlich für die Macht des Wortes einsteht

Der Autor Salman Rushdie macht Worte zu Siegern
Foto: Imago / UPI Photo
Salman Rushdie wollte kein politischer Schriftsteller sein. Er wollte, wie die meisten Schriftsteller, einfach nur Bücher schreiben. Bücher, die Menschen berühren, bewegen, begeistern. Und doch erhält der 76-jährige britisch-indische Autor nun den dezidiert politischen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Dieser soll den Einsatz der deutschen Buchbranche für „Völkerverständigung“ unterstreichen und tatsächlich passt diese etwas altertümlich anmutende Vokabel gut zur Arbeit Rushdies. Als Jugendlicher aus Mumbai nach England gekommen, überbrückt er in seinen Büchern häufig die Gräben zwischen dem Westen und Norden auf der einen und dem Süden und Osten auf der anderen. Denn natürlich ist er ein politischer Autor – aber eben nicht aus dem Antrieb, Politik zu machen, sondern gute Literatur.
Seit Mitte der 70er hat Rushdie über ein Dutzend Romane veröffentlicht. Sie zeichnen sich durch eine Tendenz zur Fantasterei aus, wobei sie vom umfassenden Wissen des studierten Historikers durchdrungen sind. Dabei lässt er sich Zeit mit dem Schreiben, was zu Beginn mit einem großen ökonomischen Risiko verbunden war. Zwischen seiner ersten, wenig erfolgreichen Veröffentlichung (Grimus, 1975) und dem Roman Mitternachtskinder, der ihm 1981 den internationalen Durchbruch bescherte, liegen sechs Jahre; bis zur Erscheinung seines Meisterwerks Die satanischen Verse vergingen weitere sieben. Rushdie ging ins Risiko und gewann: Seine Bücher gehören zum Besten, was es zeitgenössisch zu lesen gibt. Doch das Risiko wuchs ihm über den Kopf.
Denn natürlich muss man über die Fatwa sprechen, wenn man über Rushdie und den Friedenspreis spricht. Immerhin will die Jury Rushdie „für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert“ ehren. Selten wird ein Schriftsteller dafür ausgezeichnet, einfach nur am Leben zu sein.
„Die satanischen Verse“ sind ein großartiges BuchDoch wahrlich, es gehört einiges dazu, am Leben zu sein, wenn man Salman Rushdie ist. Letztes Jahr hat sie ihn eingeholt, die Fatwa, die Ajatollah Chomeini 1988 auf dem Sterbebett liegend aussprach, um seine innenpolitischen Probleme nach dem Debakel des Ersten Golfkriegs zu lösen. Der Aufruf an alle Muslime, den Schriftsteller zu töten, weil er in Die satanischen Verse den Propheten Mohammed lächerlich gemacht habe, wirkt bis heute: Bei einer Veranstaltung in New York attackierte ein Muslim Rushdie mit einem Messer und verletzte ihn schwer, unter anderem hat er die Sicht auf einem Auge eingebüßt.
Es war ein Schock gewesen, niemand war noch von einer so großen Bedrohung ausgegangen. Schon seit Langem lebte Rushdie nicht mehr unter so großem Schutz wie in den Jahren nach der Fatwa. Jene zermürbende Zeit überlebte er dank des Einsatzes der britischen Polizei und der Unterstützung vieler Freunde und Prominenter, wie sich in seiner (allerdings etwas arg kleinteilig aufgeschriebenen) Autobiografie Joseph Anton nachlesen lässt.
Joseph Anton war der Deckname, den Rushdie in den Jahren im polizeilich geschützten Untergrund trug – ein Bekenntnis zur Literatur auch hier: Joseph Conrad und Anton Tschechow standen ihm Pate. Rushdie hat eine Zeit gebraucht, bis er in seine Rolle als Symbol für die Meinungsfreiheit fand, sich oft darüber beklagt, nicht mehr für seine Arbeit, sondern für das, was er darstellt, gesehen zu werden. Deswegen soll an dieser Stelle einmal gesagt sein: Die satanischen Verse ist ein großartig größenwahnsinniges Werk, ein Fest des Fabulierens und der Verwirrung, ein witziges, mitreißendes, schönes, spannendes, erschütterndes Buch; im besten Sinne Weltliteratur.
Rushdie hat weitergeschrieben: Gegen die Angst, gegen den FanatismusUmso bewundernswerter ist es, dass er sein Recht aufs Dasein als Schriftsteller immer wieder erkämpft hat. Nach Die satanischen Verse war es alles andere als leicht, einen Verlag für seine Bücher zu finden – selbst für das seinem Sohn gewidmete so harmlose Jugendbuch Harun und das Meer der Geschichten, an dem er in seinen Verstecken schrieb.
Rushdie hat unermüdlich weitergeschrieben, gegen die Angst, gegen die Reduktion auf das Symbolhafte und auch gegen die Intoleranz und den Fanatismus. Denn ja, auch das Bekenntnis zur Freiheit steckt in seinen Büchern – nur eben nicht als Pamphlet, sondern als Fiktion, die für sich spricht. Dabei hat er sich viel bei den eigenen Prägungen und Kenntnissen bedient, was ihn immer wieder zurück zur Geschichte des Islam und nach Indien führte. In jenes Land, wo er in einer atheistischen, aber kulturell muslimischen Familie aufgewachsen war und das ihn so schmählich verriet, als es als erstes Land Die satanischen Verse verbot.
Doch Rushdie hat ihm die Treue gehalten: Auch sein jüngst erschienenes Buch Victory City (das allerdings nicht zu seinen besten zählt) spielt dort, in einem von einer Göttin gegründeten südindischen Reich im 14. Jahrhundert. Am Ende heißt es dort: „Worte sind die einzigen Sieger“. Das mag stimmen, doch zum Sieg verhelfen ihnen so großartige, mutige Schriftsteller wie Salman Rushdie.