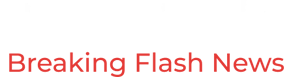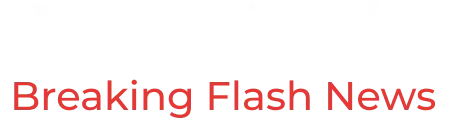„Tatort“ aus Ludwigshafen: Wer weiß schon, was echt ist?
Zahlreiche Abschiede und Ausstiege gab es im vergangenen Jahr im „Tatort“, gibt es weiter. Gestorben wird ja immer. Was einerseits der Verjüngungsoffensive der Sender dient. Jüngere Kollegen stehen schon in den Ermittlungs-Startlöchern, die älteren pflegen ihre Wunden. Oder werden gewaltsam eliminiert. Vorbei anscheinend die Zeiten, als das ZDF seinen „Ein Fall für zwei“-Haudegen Josef Matula (Claus Theo Gärtner) zum Schluss über eine Frankfurter Brücke in den Sonnenuntergang stiefeln ließ.
Erfolgreich, wenn man den Zuschauerzuspruch als Maßstab nimmt, sind im „Tatort“ zurzeit vor allem die etablierten Teams. Solche, die ihre (über-)lange Dienstzeit inzwischen mit Selbstironie kommentieren. Die Münchner zum Beispiel, natürlich die Münsteraner. Neuerdings auch die Ludwigshafener. In der neuen Folge, „Avatar“, gehen gleich zwei vom Stammpersonal mit einer Träne im Knopfloch von Bord.
Rente mit 63 und große Pläne. Für Kriminaltechniker Peter Becker (Peter Espenloer) und Frau Keller (Annalena Schmidt), zwei der sympathischsten „Tatort“-Sidekicks, war es das mit dieser Folge. Der eine fährt künftig zu Ausgrabungen in die Toskana, um das Ende der Etrusker zu erforschen: „endlich Knochen, die nicht stinken“. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts), bislang nicht für humorige Altersmilde, sondern für zeitlos engagierte Empathie bekannt, tippt erst mal auf Schliemann-Nachfolge. Schliemann? Wer kennt den denn? Nein, „Indiana Jones“!
Frau Keller fährt erst mal auf die Insel und schaut dann entspannt weiter. Zeiten ändern sich, und mit Espenloer und Schmidt verschwinden nun zuallerletzt diejenigen, die im SWR-„Tatort“ lokal eingefärbt sprechen durften, im kurpfälzischen Dialekt. Was gab es vor Jahren öffentliche Empörung, als der Stuttgarter Kollege Bienzle (Dietz-Werner Steck) den Hut nahm und mit Lannert und Bootz Hochdeutschsprechende nachfolgten! Auch über so etwas regen sich die Leute nicht mehr auf.
Nur auf den ersten Blick digitalbewegt jugendlichJedenfalls sind die Ludwigshafener nun zurück aus dem krampfigen Richard-Wagner-Opernkosmos der Folge „Gold“. Mit einer Ausgabe, die nur auf den ersten Blick einen auf digitalbewegt jugendlich macht, auf den genaueren Blick hin aber ein großartig gespieltes Drama enthüllt, das die Kommissarinnen Odenthal und Johanna Stern (Lisa Bitter) mit gemeinsamer Kombinationsgabe begleiten.

Video: ARD, Bild: SWR/Christian Koch
Die Folge „Avatar“ konzentriert sich auf Bernadette Heerwagen, auf die nach und nach enthüllte Tragödie ihrer Figur. Es geht dabei um Deepfakes und Chatbots, Cybergrooming, um Schein und Sein im Netz, falsche Identitäten, Chancen und Gefahren von KI – und um reale Taten tatsächlicher Menschen, die damit in Verbindung stehen.
Es gelingt dem „Tatort: Avatar“, sowohl dem Buch des Ludwigshafen-Kenners Harald Göckeritz als auch dem Regisseur Miguel Alexandre und der Kamera von Cornelia Janssen, solche dringenden, hochaktuellen Diskussionen nicht thematisch aufgesetzt wirken zu lassen, sondern sie zu einer menschlich berührenden, tragisch-gewalttätigen Konkretion zu verdichten. Eine, die nicht nur Eltern verstört. „Avatar“ ist der beste Odenthal-“Tatort“, mindestens seit Langem.
Ein Mann liegt tot am Rheinufer, gehobenes Bankmanagement, ein Mietwagen in der Nähe, die Spur führt zu einer erstaunlich schäbigen Pension. Die Gattin in edlem Ambiente weiß nichts über die Ausflüge ihres Mannes. Eine weitere Spur führt zur Programmiererin Julia Da Borg (Heerwagen). Sie war zur Tatzeit in der Nähe joggen. Lebt in einer Art Nicht-Behausung, einem untergemieteten Künstleratelier voller Bildschirme und Digitalgeräte. Chattet als „rosa Mäuschen“ mit erfundener Mädchen-Identität mit fremden Jungs, die ihr Bilder und Videos schicken und welche verlangen. Wer weiß schon, was echt ist? Da Borgs künstlich verfremdete Stimme, die den Jungs unschuldige Flirtangebote macht, sicher nicht. Die Identitäten der „Jungs“, die vielleicht Avatare benutzen? Als ein zweiter Mann am Rheinufer getötet wird, wissen zumindest die Zuschauer schon, dass Da Borg die Mörderin ist. Odenthal ist misstrauisch, sieht aber kein Motiv.
Ein „Whydonit“, kein „Whodunit“ ist „Avatar“. Nicht um das „Wer?“, sondern um das „Warum?“ geht es. Allmählich enthüllen sich, während Da Borg mit ihrer verzweifelten Stieftochter, der 13-jährigen Sina (Ziva Marie Faske), per Videochat verbunden ist, Mutter-Kind-Versäumnisse. Eine Geschichte lässt sich rekonstruieren, ähnlich der in „Das weiße Kaninchen“. Der vielfach ausgezeichnete Film von 2016, gleichzeitig Debüt von Lena Urzendowsky, behandelte das Phänomen Cybergrooming so atemberaubend wie entsetzlich – und wirkt nun schon, angesichts der Entwicklungen der digitalen Möglichkeiten des Missbrauchs, wie aus einer Steinzeit des Internets.
„Avatar“ konzentriert seine Handlung vor allem auf die Schuld der (Stief-)Mutter, auf das Umfeld Sinas, ihre Freundin Marie (Leni Deschner), Ex-Freund Tom (Caspar Hoffmann) und auf eine weitere Patchworkfamilie, in der Stiefvater Pit (Felix von Bredow) die Onlineaktivitäten von Bastian (Luis Vorbach) für eigene Zwecke nutzt. Maximal widerlich ist etwa die Szene, in der Pit im Kaufhaus, zufällig beobachtet von Partnerin Manon (Sabine Timoteo), einen Kinderbikini aussucht. Wären alle Ludwigshafener-“Tatorte“ wie dieser, aktuell, relevant, generationenübergreifend diskussionswürdig und mit solchen Hauptfiguren, bedürfte es weder des Generationenwechsels noch weiterer Pensionierungsvorstellungen.
Der Tatort: Avatar läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.