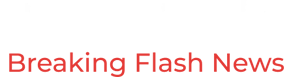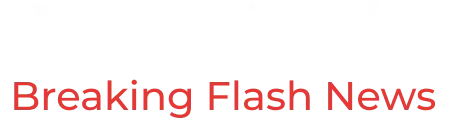Wimbledon: Alexander Zverev sieht sich auf Rasen als Titelkandidat

Die Welt kann sich noch so rasant verändern, in Wimbledon bleibt alles so, wie es ist. Das älteste und wichtigste Tennisturnier ist etwas für Traditionalisten. Nirgendwo auf der Tour gibt es so viele Bräuche, die sich etabliert haben. Weiße Kleidung, lila Blumen, rote Erdbeeren. Alles wie gehabt. Jedes Jahr aufs Neue. Und doch ist diesmal etwas anders.
„Es ist vielleicht das offenste Turnier, das wir in den vergangenen 20 Jahren hatten“, sagt Alexander Zverev. 19 Mal am Stück haben Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal oder Andy Murray das Turnier gewonnen, ehe Carlos Alcaraz sich 2023 zum neuen Champion aufschwang. Das war ein altersbedingter Bruch mit der Tradition – ob es den Organisatoren, die von den vielen großen Duellen profitierten, gefiel oder nicht.
Rasen-Titel fehlt
In diesem Jahr scheint das Feld offen wie lange nicht, und Zverev kann ganz gut leben damit: „Es ist das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, hier ein Kandidat zu sein, der vielleicht den Titel gewinnen kann“, sagt er. Spätestens an dieser Stelle sollten nicht nur die Traditionalisten stutzig werden.
Es wäre ungerecht, den besten deutschen Tennisspieler der Gras-ist-etwas-für-Kühe-Fraktion zuzuordnen, der Ivan Lendl einst angehörte. Aber als Mann für die Grashalme ist Zverev bisher nicht in Erscheinung getreten. Ein Rasen-Titel fehlt ihm noch. In Wimbledon war zweimal im Achtelfinale Schluss. Warum sollte diesmal alles anders werden?
Zverevs Sinneswandel hängt mit seiner guten Form zusammen, die ihn zuletzt ins Finale von Roland Garros führte. Er ist aber vor allem Ausdruck einer veränderten Herangehensweise. In der Vergangenheit glaubte Zverev, nicht, in der Lage zu sein, auf Rasen gutes Tennis zu spielen. „Ich habe immer das Gefühl gehabt, der Rasen ist zu stressig“, sagt Zverev: „Ich kann nicht in den wichtigen Momenten wie in Paris am Anfang im Tiebreak eine Rallye über 40 Schläge gewinnen.“
Nicht die Schönheit zählt
Der grüne Untergrund liegt ihm nicht, weil die langen Grundlinienduelle ausbleiben und weil Zverev trotz Fortschritten noch immer mit dem Spiel am Netz fremdelt. „Man muss akzeptieren, dass das Match vielleicht nicht so schön ablaufen wird wie auf anderen Belägen“, sagt Zverev. Er wolle nun kein schönes Tennis spielen, sondern vielmehr einen Weg finden, zu gewinnen: „Das ist ein mentales Ding, das man mit sich selbst vereinbaren muss. Wenn ich das tue, glaube ich, dass ich eine Chance habe.“
Nach seiner Ankunft in Wimbledon klang der 27 Jahre alte Deutsche ein bisschen wie ein eigentlich guter Schüler, der sich im Halbjahreszeugnis den Notendurchschnitt mit einem Fach versaut hat, weil es ihm keinen Spaß macht – der nun aber bereit ist, dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben.
Dass er Qualitäten hat, die ihn auf diesem Untergrund von anderen abheben, wird ihm schon länger gesagt. Zverev selbst führt seinen Aufschlag und seine Rückhand an. „Ich kann die Ballwechsel auch kürzer halten, wenn ich möchte.“ Vielleicht reichen der Glaube an sich selbst und die Kraft der Gedanken. Im Tennis kann allein das manchmal viel verändern.
Vor seinem Erstrundenmatch gegen den Spanier Roberto Carballés Baena am Dienstag wirkt Zverev nicht so, als würde ihn die Finalniederlage von Paris gegen Alcaraz noch sonderlich beschäftigen. Der Deutsche macht einen aufgeräumten Eindruck. Als ein Reporter fragt, wie er seine Zeit in London am liebsten verbringe, plaudert Zverev drauflos. Abseits des Platzes sei er wie ein Kind, das nicht still sitzen könne. Während des Turniers wohne er mit seinem Bruder und dessen Kindern in einem Haus mit großem Garten. Als er dort ankam, habe er sofort ein Mini-Tennisnetz und ein Neun-Loch-Golfset mit Plastikbällen bestellt. Nun wird nach dem Training fleißig gezockt. Ob neun Löcher reichen, dürfte auch davon abhängen, wie weit Zverev sein Neustart auf Rasen trägt.