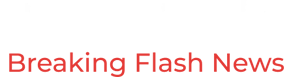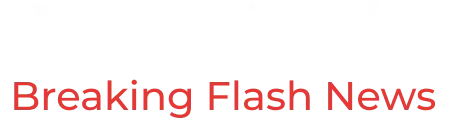Auf Deutsch übersetzt bedeutet das englische Wort „Maverick“ soviel wie „Alleingänger“ oder „politischer Freigeist“. Es hat auch Anklänge an das persönliche Risiko, das eine Person einzugehen bereit ist. Insofern ist Cannes gerade Gastgeber für die beiden größten Mavericks, die das amerikanische Kino noch zu bieten hat.

Francis Ford Coppola hat einen Teil seiner hochprofitablen Weinkellereien in Kalifornien verkauft, um die 100 Millionen Dollar für sein Herzensprojekt „Megalopolis“ aufzubringen, an dem er vier Jahrzehnte laboriert hatte. Kevin Costner hat zehn Morgen seines Strandgrundstücks in Kalifornien verpfändet, um die 100 Millionen für „Horizon“ aufzubringen, das Projekt, das ihm seit dreieinhalb Jahrzehnten keine Ruhe ließ.
Nun haben die beiden Mega-Tanker in der Bucht von Cannes symbolisch Anker geworfen, neben realen Riesenkreuzfahrtschiffen. „Megalopolis“ fand vor einer Woche einen – bestenfalls – gemischten Empfang, und nun haben wir auch „Horizon: An American Saga“ gesehen. Der Film beginnt mit dem Logo der Produktionsfirma, die Territory Pictures heißt, und sinnbildlicher könnte sie gar nicht heißen, dann die nächsten dreieinviertel Stunden wird es um die Erschließung eines neuen Territoriums gehen, die große Landnahme der weißen Siedler Mitte des 19. Jahrhunderts, das Besetzen von Raum im Westen. Dem folgt die Silhouette eines Indianers mit aufgepflanztem Speer, der von einer Erhöhung ins Land herunterblickt. Und dort sieht er einen Landnehmer mit seinem Sohn, die an einem Fluss ihren Claim des Landes ausmessen und abstecken. Wir schreiben das Jahr 1859.
Lesen Sie auch
Costner lässt sich Zeit. Die hat er, sechs bis sieben Stunden mindestens, denn was man in Cannes zu sehen bekam, war nur Teil eins, der zweite ist abgedreht. Und Costner redet sogar von vier Teilen. Vater und Sohn werden wir nicht mehr sehen, als Jahre später neue Siedler an den Fluss kommen, finden sie nur zwei Kreuze. Und viele Kreuze werden folgen, denn eines Nachts überfallen die Apachen das Dörfchen und brennen alles nieder. Nur wenige Weiße entkommen.
Die US-Kavallerie trifft am nächsten Morgen ein und findet wenig mehr als rauchende Trümmer – und die Überlebenden, die jetzt erst recht weiterziehen möchten. Der schmucke Leutnant warnt sie, dieses Land gehöre den Indigenen und die Armee werde sie auf ihrem Weg nach Westen nicht beschützen können. Es ist ein bisschen wie bei der Legende von der deutschen Wehrmacht, die sich im Zweiten Weltkrieg nicht beschmutzt habe; ein Offizier der US Army, der den Landraub der Siedler nicht auch noch mit seinen Soldaten flankieren möchte. Dies ist keine amerikanische Saga, wie der Titel es uns weismachen möchte, sondern eine Saga der weißen Vereinigten Staaten, und darin muss wenigstens eine Institution unbefleckt bleiben, nämlich die Blauröcke der Kavallerie.
Wir hören dann, kurz hintereinander, zwei Reden, die interessanterweise beide ziemlich das Gleiche aussagen. Die erste stammt von dem schmucken Leutnant, der den Siedlern klar zu verstehen gibt, dass sie kein Recht hätten, sich dieses Land anzueignen, aber auch prophezeit, dass ihnen immer neue Wellen folgen werden, sodass das Recht bald keine Rolle mehr spielen werde.
Nachdenken über das Leben an der Frontier, der Grenze zur Wildnis: Szene aus „Horizon“
Quelle: Courtesy Festival de Cannes 2024/Warner Brothers
Die zweite Rede stammt von einem Kriegerhäuptling, der seinen jungen Hitzköpfen die Lektion erteilt, dass sie zwar ein paar Schlachten gewinnen können, aber nicht den Krieg. Wir hören die Rede, nachdem der Film – ungefähr eine Dreiviertelstunde ist vergangen – aufgehört hat, die Indianer als brennende, mordende Masse zu zeigen und ihnen ein wenig Individualität gibt, unter anderem eine junge Frau mit ihrem Baby; dieselbe Konstellation findet sich auch auf der weißen Seite wieder.
Doch Costners Film könnte sich nicht als „amerikanische Saga“ inszenieren, wenn er allzu viel aus der indigenen Sicht erzählen würde, das ist nicht die Saga, die gemeint ist. Später im Film gibt es noch einen ebenso brutalen Überfall der überlebenden Siedler auf ein Indianer-Lager, der vermutlich von den Filmemachern als quid pro quo gemeint ist: „Seht her, auch die Weißen haben böse Taten begangen, wir sind ja gar nicht einäugig!“ Aber letztlich wirkt es zu sehr wie eine (verstehbare) Rache für den ersten Überfall am Fluss. Hollywood war schon vor 50 Jahren in „Little Big Man“ wesentlich weiter in der Aufarbeitung der tatsächlichen historischen Ereignisse. Selbst Costners eigener „Der mit dem Wolf tanzt“, der auch in der Bürgerkriegszeit spielte, war damit verglichen schon fortschrittlicher und zeigte klischeefreie indianische Figuren.
Ein weißer FilmDoch dies ist ein weißer Film, was sich schon im Titel zeigt: Die Siedler haben sich alle wegen eines Flugblatts mit der Überschrift „Horizon“ auf den Treck gemacht. Sie versprechen sich einen offenen Horizont und unendliche, unbesiedelte Weiten. Es ist, als würde man die deutsche Kolonialgeschichte in Südwestafrika weitgehend aus der Sicht der Siedler erzählen, die sich in „unbesiedelte“ Weiten eines neuen Kontinents aufmachen: Ja, da gab es ein paar unerfreuliche Ereignisse, aber im Wesentlichen feiern wir die Pioniere!
Man kann „Horizon“ wohl nicht ohne den Zusammenhang mit „Yellowstone“ sehen, jener Serie, in der Kevin Costner einen Rancherpatriarchen spielt (genauer gesagt: spielte, er hat sich nach der fünften Staffel im Zwist mit den Produzenten verabschiedet). Die Serie gilt als Saga für trumpige Rednecks, obwohl sie so starke Frauen- und Indianerrollen wie keine andere zu bieten hat. Wie auch immer man sie interpretiert, sie bietet ein Identifikationsangebot für die traditionellen amerikanischen Werte: Familie, Authentizität und das Leben in der Natur.
Damit sind wir bei der „Eroberung des Westens“, wo diese Werte auch immer im Mittelpunkt standen – zumindest in fast allen Hollywood-Filmen, die diese Eroberung zum Thema hatten. Costner hatte „Horizon“ schon vor 20 Jahren Disney angeboten, die Verhandlungen waren weit gediehen, man war nur noch fünf Millionen Dollar voneinander entfernt, doch kam letztlich nicht zusammen. Wahrscheinlich war die Zeit noch nicht reif für eine patriotische Selbstvergewisserung durch eine Rückkehr in die glorreichen Tage der Ausdehnung des amerikanischen Imperiums.
In „Horizon“ soll der Western wiederbelebt werden.
Quelle: Courtesy Festival de Cannes 2024/Warner Brothers
Jetzt scheint es so weit zu sein – zumindest in der Theorie. In der Praxis von „Horizon“ ist dies allerdings nicht wirklich eine Saga. Dazu fehlt ihr der große filmische Atem. Die Figuren werden ohne die Ruhe, die ein Epos haben muss, schludrig eingeführt. Costner nimmt sich nicht die Zeit, um sie dem Zuschauer emotional ans Herz zu legen. Er schneidet zwischen ihnen hin und her, ohne sie richtig zu etablieren; manchen Situationen lässt er zu viel Zeit, anderen zu wenig. Man erfährt kaum etwas über den Hintergrund der Charaktere, und wenn Costner schließlich nach einer Stunde als Pferdehändler auf der Leinwand erscheint, bleibt er eine ebenso vage Figur wie fast alle anderen.
Die dreieinviertel Stunden fühlen sich an wie der Auftakt zu einer Mini-Serie: Die Geleise werden gelegt in viele Richtungen, in die man sich später bewegen möchte – nur hat man den Eindruck, dass die meisten Geleise in Richtungen führen, die nicht besonders interessant sein werden. Der Western wird seit einem halben Jahrhundert totgesagt, und trotzdem bekommen wir immer wieder Exemplare zu Gesicht, die das Gegenteil zu beweisen scheinen. Totgesagte leben länger – „Der mit dem Wolf tanzt“ war ein solches Exemplar. Und doch, solche Ausnahmen beweisen eigentlich nur die Behauptung: Der Western ist wirklich tot, und er lebt nur in anderen Genres weiter, die sich seiner Konventionen bedienen. Nach „Horizon“ sollte niemand behaupten, dies sei eine Wiederbelebung.