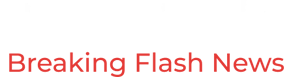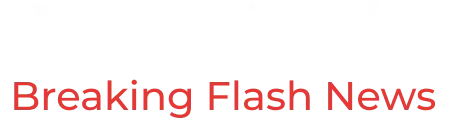Fischtown Pinguins: Die Geschichte des Trainer Thomas Popiesch
Es gibt da diesen Satz, der will irgendwie nicht aussterben. Den hört Thomas Popiesch seit 30 Jahren immer wieder mal, sagt er. Im Moment hört er ihn gerade wieder gehäufter, im Moment häufen sich die Anfragen bei ihm. 30 Jahre Mauerfall, da liegt eine Anfrage nahe. Deutsch-deutsche Geschichten haben viele zu bieten, eigentlich ja jeder, der ein bisschen älter ist. Aber solch eine verdichtete Geschichte? Mit Fluchtversuchen, DDR-Knast, kilometerlanger Stasi-Akte? Mit verhunzter Ost- und erfolgreicher Westkarriere, als Profi und 2018 dann Eishockey-Trainer des Jahres? Also Herr Popiesch, wie gefällt Ihnen denn so der Satz, dass nicht alles schlecht war in und an der DDR?

„Eigentlich“, sagt der Trainer der Fischtown Pinguins, „gefällt er mir null.“ Er sagt das Erwartbare, er begründet es aber nicht mit Erwartbarem. Er könnte da ganz leicht in eine Opferrolle hineinschlüpfen. Man schnappte ihn an der tschecheslowakischen Grenze, als er 17 war, er saß vier Jahre lang in Bautzen, in diesem berühmt-berüchtigten Gefängnis. Auch später ließen sie ihn nicht in den Westen, sein Eishockey-Traum lag in Scherben. Er war ein Ausgestoßener des Systems, ohne dem System entkommen zu können.
Abrechnung ohne Abrechnungsmodus
Dass er diesen War-nicht-alles-schlecht-im-Osten-Sprech nicht mag, hat jedoch wenig mit ihm als Opfer zu tun. Eher mit einem in seinem Fall erstaunlich analytischen Ansatz. Einem analytisch-philosophischen Ansatz, könnte man sagen. Na logisch, sagt er, sei nicht alles schlecht gewesen. Schlecht im Sinne von schlimm. Er habe eine tolle, eine umsorgte Kindheit gehabt. Eine Top-Ausbildung genossen. Das Sportfördersystem, in das er hineinwuchs, sei gut und ausgeklügelt gewesen. „Nur“, sagt Popiesch, „es war auf Dauer nicht bezahlbar.“ Eine Illusion auf Zeit quasi. Wenn er jetzt einen hohen Kredit aufnehmen und zwei Wochen über seine Verhältnisse leben würde, dann würde er rückblickend wohl auch sagen: War nicht alles schlecht in den zwei Wochen. Man hat sich etwas vorgemacht. Thomas Popiesch gehört nicht zu den Leuten, die sich auch 30 Jahre danach noch etwas vormachen wollen.
Er kann mit der DDR abrechnen, ohne in einen Abrechnungsmodus zu verfallen. Nein, auch den Satz, dass die DDR ihm seine Jugend geraubt habe, den könne er so nicht stehen lassen. „Da wurde nix geraubt“, sagt er. Im Gegenteil: Ihm sei ja alles gegeben worden: Ausbildung, Förderung. Er hat sich gegen dieses System entschieden, in dem man so lange funktioniert, so lange man Ja sagt. Er hat diese Entscheidung für sich getroffen. Und die Konsequenzen getragen.
So sieht er das, in diesem Geiste versucht er heute seinen Spielern eine Haltung zu vermitteln: Alles, was du tust, hat Konsequenzen! Du bist verantwortlich für dein Handeln! Sein Blick zurück sei vollkommen frei. Man sagt von dem mittlerweile 54-jährigen Chefcoach eines DEL-Teams: Er ist sehr klar in der Ansprache und braucht dazu nicht erst wohlklingende Parolen. Er passt gut zum Malocher-Image der Pinguins, die mit knappem Etat fleißig punkten in der DEL.
Popiesch beantragt immer wieder ReisegenehmigungenPopieschs Konsequenz damals hieß, nun ja, Ende Gelände. Zehn Monate U-Haft in Berlin-Hohenschönhausen. Achtung! Gesicht zur Wand!! Dreieinhalb Jahre Haft in Bautzen wegen Republikflucht. Ende der Sportkarriere als verheißungsvolles Eishockeytalent vom SC Dynamo Berlin. Ein bisschen Autos reparieren, ein bisschen Schmuck verkaufen. Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit. Und: ein zweiter Fluchtversuch.
Jahr für Jahr habe er nach seiner Haftentlassung 1986 eine Reisegenehmigung beantragt. Für Bulgarien, für Ungarn. Im Frühjahr 1989 bekam er sie. Popiesch glaubt heute, dass es ein Versehen war. So ähnlich wie später dann diese legendäre Schabowski-Antwort („Also, äh, meines Wissens sofort, unverzüglich“) auf jener legendären Pressekonferenz am 9. November. Eigentlich hatten die Behörden im Frühjahr 1989 wohl seinem Vater die Ungarn-Reise genehmigen wollen, nicht ihm.
Er hätte es ohne die neuesten Entwicklungen nicht erneut probiert, in den Westen zu gelangen. Das Risiko, erneut im Gefängnis, in Bautzen zu landen, war zu hoch. Doch er hatte gehört: Aufgegriffene an der grünen Grenze zu Österreich werden ins Landesinnere zurückgeschickt, nicht aber an die Staatsorgane gemeldet. So erlebte Thomas Popiesch schließlich seinen ganz privaten Mauerfall, ein halbes Jahr vor dem Mauerfall. Sein emotionaler Ich-bin-frei-Moment war kein geöffneter Schlagbaum an der Bornholmer Straße, auch nicht die TV-Bilder davon. Es war der Anblick eines österreichischen Försters auf einem österreichischen Hochstand.
Eine Nacht lang war er durch den Wald geirrt. Ganz einfach, hatte man ihm gesagt. Da lang und dann da, und dann immer gerade aus. Nach einer Stunde in der Finsternis hatte er komplett die Orientierung verloren. Kletterte über einen Zaun, fiel in einen Bach, schleppte sich schließlich entkräftet auf einen Hochstand. Ob der zum Westen oder zum Osten gehörte, wusste er nicht. Als er am Morgen den Förster sah, wusste er: Westen. Wegen des Försterhutes mit Gams. Später erzählte ihm der Mann, dass auch die ungarischen Förster so einen Hut tragen.
Popieschs Stasi-Deckname: "Eis"Popiesch muss lachen, als er das erzählt. Die deutsch-deutschen Geschichten, sie haben oft auch eine ganz spezielle Komik. In seiner Stasi-Akte, erinnert sich der Pinguins-Coach, hätte man ihm einen Decknamen verpasst. Er sei „Eis“ gewesen, sein Kumpel „Stiel“. Seine Akte habe aus 16 Ordnern bestanden. „8000 Seiten“, sagt Popiesch, „die Hälfte davon allerdings geschwärzt.“ Dass ein Schwager als IM aktiv war, habe er geahnt, von zwei weiteren IMs versuchte er vergeblich, die Klarnamen zu erhalten. Persönlichkeitsrechte, habe man ihm gesagt. Wirklich Wahnsinn, mit welcher Akribie und mit welchem Aufwand er beobachtet und beschattet worden sei.
Wirklich Wahnsinn. Wirklich ein Wunder. Als staunender Betrachter – „es war ja nicht mehr mein persönliches Ding, ich war ja schon weg“ – erlebte der damals 24-Jährige dann den tatsächlichen Mauerfall. Er saß in Duisburg vor dem Fernseher, als die Schabowski-PK lief. Er saß da in Duisburg als Deutscher und als Ausländer. Er durfte nur trainieren, nicht spielen, es lief noch eine automatische 18-monatige Sperre bei Wechseln von einem Nationalverband in den anderen. Ungläubig verfolgte er, was geschah. „Wie in einem Fernsehfilm“, sagt er.
Er hatte sich nicht vorstellen können, dass die Mauer fällt. Beziehungsweise: Dass sie so fällt. Er hatte gedacht, dass die DDR das durchzieht, es bis zum Schluss und schlimmstenfalls mit Waffengewalt verteidigt. Er konnte sich auch die schnelle Wiedervereinigung nicht vorstellen, nicht diesen Wechselkurs von Ost- zu Westmark bei der Währungsunion. 1:10, vielleicht gar 1:20, orakelten die Leute, während es am Ende 1:1 und ab 4000 Mark 1:2 wurde. Wenn Thomas Popiesch so über damals erzählt, wird die Wucht der historischen Ereignisse spürbar. Und obwohl dieser Mann mit dieser speziellen deutsch-deutschen Geschichte das ohne Anflug von Pathos erzählt, quasi aus der Perspektive des Beobachters, wird es trotzdem gut spürbar. Es war eine richtig große Sache.
Thomas Popiesch an der Bank der Fischtown Pinguins.
Foto: imago sportfotodienst
Bisweilen gerät das ja zu sehr in den Hintergrund in all der Ost-West-Befindlichkeit, bei der Thematisierung des Ost-West-Gefälles. Popiesch hat Glück gehabt, nachdem der Förster ihn auf dem Hochstand fand. Hinterm Horizont gings weiter. Ein Freund und Geschäftsmann aus Düsseldorf unterstützte und förderte ihn, er konnte als Spieler, später als Trainer, seinen Traum vom Eishockey leben. Als Spieler in Duisburg, Krefeld, Nürnberg oder Frankfurt. Als Trainer in Weißwasser, in Dresden und seit 2016 in Bremerhaven. Schon damals zu Ostzeiten hatten ihn seine Eltern – Vater Bauingenieur, Mutter Unterstufenlehrerin – nach Kräften unterstützt und nie fallengelassen.
Ost-West-Leben ohne Ost-West-DingEr erlebte nach dem ersten Jahr voller Einig-Vaterland-Euphorie die Ossi-Sprüche im Westen, die Wessi-Sprüche im Osten. Er empfand in den 1990-er Jahre seine Heimatstadt Berlin als gespaltene Stadt. Aggressive Stimmung, Baustellen auf den Straßen und in den Köpfen. Er erlebt heute ein anderes Berlin. Damals habe er gesagt, er würde nie wieder zurückgehen nach Berlin. Heute wäre er nicht abgeneigt. Dass Regionen im Jahr 30 nach der Wende abgehängt sind, dass Menschen sich abgehängt fühlen, das ist für ihn kein Ost-West-Ding. Es werde benutzt, es erscheine halt manchem für seine Zwecke nützlich, dieses Bild zu malen. „Gehen Sie doch mal in Ecken von Duisburg“, sagt er, da könne man sich dem Abgehängt-Thema auch prima widmen. Er habe nicht das Gefühl, dass dieser Ost-West- und Damals-Heute-Vergleich noch wirklich objektiv dargestellt wird.
Nein, er will eher der Mann mit der Ost-West-Biografie sein, für den das Ost-West-Thema keines mehr ist. „Ganz ehrlich“, sagt Thomas Popiesch bei dem Gespräch Anfang Oktober in seinem Büro in der Bremerhavener Eisarena, „viel lieber als darüber würde ich mit Ihnen über das 3000-Meter-Hindernis-Finale gestern bei der Leichtathletik-WM reden.“ Irgendwie ist dieser Satz dann ja aber doch auch ein ganz guter Satz 30 Jahre nach dem Mauerfall.
Zur Startseite