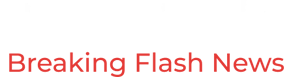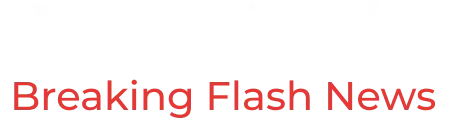Wolfgang Becker: Ein Raum für Verwirrung im Einheitsstrudel
Nicht nur mit "Good Bye, Lenin!" forderte Wolfgang Becker gesamtdeutsche Gewissheiten heraus, weit vor der Neubewertung der Neunziger. Nun ist er mit 70 Jahren gestorben.

14. Dezember 2024, 14:16 Uhr
Ihr Browser unterstützt die Wiedergabe von Audio Dateien nicht. Download der Datei als mp3: https://zon-speechbert-production.s3.eu-central-1.amazonaws.com/articles/a50a5f2b-de81-45a7-ac12-395df9ebde0c/full_c2feebaa92d99f62cf1b71fa6304d20f1ebc7c74b345b5e9af0e3fb6052271f842ee32acc99e3654dfe8e61d1a270d7b.mp3
Deutschland war eine Baustelle. Ein Land zwischen den Zeiten, unfertig, kaputt, auf der Suche nach sich selbst. Die Menschen schienen verloren, obwohl oder weil die Geschichte, so wurde es verkündet, an ihr Ende gekommen war. Die Neunzigerjahre, so war die Verheißung, waren deutsche Einheit und deutsche Euphorie.
Aber ganz so einfach war es nicht, und es war das besondere Geschichtsgespür von Wolfgang Becker, der gerade im Alter von 70 Jahren gestorben ist, diese Widersprüche einer Gesellschaft einzufangen, die das Gestern genauso beherbergte wie das Morgen – aber das Gestern überwog und das Morgen war recht ungleich verteilt.
Becker schaffte es, mit seinem ersten großen Spielfilm, diese Stimmung einzufangen: Das Leben ist eine Baustelle aus dem Jahr 1997 war Beckers Durchbruch als Regisseur und bleibt bis heute ein Epochenzeugnis für eine verwirrte Zeit, für verwirrte Menschen, für die Kräfte, die auf Menschen wirken, wenn sich Geschichte außerhalb der gängigen Sichtweisen auf sie verdichtet – ein Einzeiler als Zeugnis dieser deutschen Übergangsperiode.
Der Film erzählt die Geschichte von Jan – und Jürgen Vogel, der diesen Jan spielt, war nicht nur das ambivalent ratlose Gesicht dieses Films. Er wurde zu vielleicht dem symptomatischen Schauspieler dieser Epoche, gefangen zwischen der evidenten Männlichkeit seines Körpers (Muskeln, Tattoos, blonde Haare) und einer spürbaren Schlaffheit, die übergreifend und generationstypisch war: das verunsicherte Geschlecht.
Dieser Jan ist in vielem ein kleiner Bruder von Kurt Cobain, dem Sänger der Band Nirvana, der sich 1994 das Leben nahm und zuvor einer Generation den Soundtrack geschenkt hatte, die Verzweiflung, die Wut auf die Verhältnisse. Jan aber, der allen Grund zur Wut hätte, taumelt eher durch sein Leben, als dass er es selbst lebt. Es ist eine Baustelle – die Frage ist nur, ob es eine Renovierung ist, ein Neubau oder ein Abriss.
Das Berlin, in dem Jan zu Hause ist, stand damals immer noch voller Ruinen – und auch Jans Leben fällt rapide auseinander. Er versagt beim Sex, er verliert seine Arbeit, er findet seinen Vater tot und verlassen in der Wohnung, es ist ein Elend, das Becker mit Humor und Respekt und großem Gespür für die soziale Realität dieser Zeit inszeniert.
Der Film, der Christiane Paul als zweites prägendes Gesicht dieser Zeit neben Vogel etablierte, ist eine Moritat des neuen Deutschlands. Aids spielt eine Rolle – heute fast vergessen, wie tief in die Neunzigerjahre diese Krankheit, diese Angst reichte. Ferner Arbeitslosigkeit, Abstiegssorgen – eine Unterschicht, die Becker mit einem besonderen Talent für das leichtfüßig Tragikomische zeigte, wie es in Deutschland selten ist.
Das Leben ist eine Baustelle zeichnete eine zugewandte Skepsis aus gegenüber dem, was gerade in Deutschland geschah, eine durchaus politische Sensibilität für die historischen Verwerfungen, ein zartes Geschichtsgefühl, das eher von den Menschen ausgeht als von der Macht, eher von den kleinen Begebenheiten, Schicksalen genannt, als von dem, was Staaten, Länder, Nationen durchleben.
Ostalgie vor der OstalgieDiese Genauigkeit im Detail, dieser sehr eigensinnige Blick auf Deutschland, seine Gegenwart und Geschichte, machte auch Beckers Film Good Bye, Lenin! zu einem Ereignis: Über dessen erzählerische Qualität hinaus fing Becker eine Stimmung ein und prägte sie damit, noch bevor die Nostalgiewallungen der deutschen Selbstromantisierung richtig spürbar waren.
Der Film wurde auch deshalb ein nationaler und internationaler Erfolg, weil er in dem scheinbar widerspruchsfreien Einheitsstrudel einen Raum für Zweifel, für Verwirrung, für Fragen schuf, die politisch heute wieder relevant sind: Was war die DDR für ein Land, was war das Leben in diesem Land, was ist Erinnerung wert, als Anker, manchmal bleischwer, manchmal eine Versicherung gegen die Drift der Gegenwart?
In unserer Zeit sind es Bücher wie die von Katja Hoyer (Diesseits der Mauer) oder Dirk Oschmann (Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung) einerseits und Ilko-Sascha Kowalczuk (Freiheitsschock) oder Steffen Mau (Ungleich vereint) andererseits, die diesen politisch aufgeladenen Erinnerungsraum vermessen, der durch die Erfolge von AfD und BSW zu einem realen Problem kommender Regierungsmacht wurde.
Im Jahr 2003, als Good Bye, Lenin! in die Kinos kam, war die Zeit noch heiterer und argloser, so scheint es im Rückblick. Umso erstaunlicher war die Sicherheit, mit der der Westdeutsche Becker diese so ostdeutsche Geschichte erzählte: von der Mutter, die das Ende der DDR nicht mehr erlebte, weil sie vor dem Mauerfall ins Koma fiel, die im Juni 1990 aus dem Koma erwacht und fortan von ihrem Sohn vor der historischen Erkenntnis verschont wird, weil für sie der Schock vom Ende der DDR lebensbedrohlich sein würde.
Becker inszeniert auch diese Tragikomödie mit sanfter Sicherheit, Daniel Brühl ist der Sohn, der die DDR-Gegenwart als echtes Zitat für seine Mutter inszeniert, gespielt von Katrin Sass. Es sind die Gurken, die sie liebte, die Sendungen, die sie sah, die Erinnerungen, die sie prägten. Becker schuf mit diesem Antiwendefilm ein Wendedokument ganz eigener Art, kontrafaktisch und darum umso wahrer.
Auch hier setzte Becker, politisch denkend, einen Film als Gegengewicht eines strahlenden (und bei Veröffentlichung des Films gerade zu Ende gegangenen) Jahrzehnts, klug, gar nicht zynisch und mit Sinn für das epische Erleben in den Details des Lebens. 6,5 Millionen Menschen sahen Good Bye, Lenin! allein in Deutschland, Becker gewann damit den Filmpreis Felix und den César, beides Mal als "bester europäischer Film". Es war Ostalgie vor der Ostalgie und weckte damit das Bewusstsein für etwas, das verloren gegangen war: okkupierte Erinnerung.
Deutsche Geschichte und soziale RealitätBecker, der 1994 gemeinsam mit Tom Tykwer, Dani Levy und Stefan Arndt die einflussreiche Produktionsfirma X Filme gegründet hatte, geriet dann bei seiner dritten großen Kinoproduktion mit seiner kinematografischen Menschenfreundlichkeit an seine Grenzen. Die Verfilmung von Daniel Kehlmanns Roman Ich und Kaminski, bei der wiederum Daniel Brühl die Hauptrolle spielte, kam 2015 ins Kino und zog nur 120.000 Zuschauer an – erzählt wird die Geschichte zweier Antihelden, eines arroganten Kunstkritikers und eines tricksenden Malerfürsten.
Was hier fehlte, war Beckers eigentliches Material: deutsche Geschichte und soziale Realität. Beides fand er in dem Roman Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße von Maxim Leo, dessen Verfilmung Becker noch vor seinem Tod abschloss. Der Stoff hat die kontrafaktische Leichtigkeit, die auch Good Bye, Lenin! auszeichnete: Ein Videothekenbesitzer, der kurz vor der Pleite steht, wird zum 30. Jubiläum des Mauerfalls von einem Journalisten fälschlicherweise zum Helden des Widerstands gemacht, weil er 1983 angeblich 127 Passagieren einer S-Bahn zur Flucht in den Westen verholfen hat.
Das Ensemble dieses Films wiederum liest sich wie ein Vermächtnis der Neunzigerjahre: Charly Hübner spielt die Titelrolle, Christiane Paul ist wieder dabei, Daniel Brühl, Jürgen Vogel. Ein Satz aus dem Roman könnte wie ein Motto über dem schmalen, schönen Werk von Wolfgang Becker stehen: Jeder, heißt es da, "sah, was er sehen wollte, jeder verstand, was er verstehen wollte. Das Leben war ein Spiel des Erinnerns und Vergessens."
Am 12. Dezember ist Wolfgang Becker nach schwerer Krankheit in Berlin gestorben.