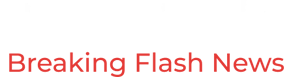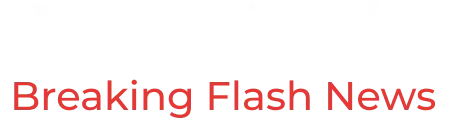Es beginnt immer schon ein paar Wochen vor dem Fest. Im Hof, wo sonst zu dieser Jahreszeit ab 16 Uhr in den Wohnzimmern das Licht angeht, bleibt es hinter den meisten Fenstern dunkel. Viele meiner Nachbarn sind dann schon „nach Hause“ gefahren – ein Euphemismus dafür, an jenen Ort zurückzukehren, aus dem man mal gekommen ist, um aus Berlin eine Heimat zu machen. Kurz vor Weihnachten dann wird es zunehmend dunkler in meinem Haus, noch ruhiger als sonst, und ich weiß, dass am Weihnachtswochenende nur noch ein, zwei Leute da sein werden. Und ich.

Viele Menschen finden den Gedanken bedrückend, die Weihnachtsfeiertage alleine zu sein, in einer Stadt, die dann wirkt wie aus einem Roman von Marlen Haushofer. Auf mysteriöse Weise entvölkert, leer, ausgestorben. Für mich: ein Traum! Das sind die drei Tage des Jahres, an denen ich meine Batterien aufladen kann. Niemand will etwas von mir, denn alle sind mit ihren Familien beschäftigt. Mit Essen, Trinken, Geschenken, Streitereien. Das klingt nach einem normalen Weihnachtsfest. Doch ich habe das alles in hochemotionaler Form in einer Familie mit ohnehin sehr ausgeprägten Charakteren ein paar Mal zu oft genossen, als dass ich es noch mal erleben möchte.
Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen
Von Jahr zu Jahr quälte ich mich und andere durchs Fest. Schwitzte in überheizten Räumen und saß überfressen an großen Tischen. Ich trank zu viel, wir stritten zu heftig und mehrmals sagten wir uns Dinge, die man so schnell nicht wieder vergisst. Die noch bis zum Frühjahr nachhallten bei jedem Familiengespräch und die dann spätestens am nächsten Heiligabend zeigten, dass der Affektkern immer noch auf sehr kleiner, doch fatal heißer Flamme brannte. Jedenfalls heiß genug, um jederzeit einen generationsübergreifenden Flächenbrand damit zu entfachen. Irgendwann lastete der Gedanke an die Weihnachtsfeiertage wie ein Stein auf mir, schon Wochen vorher spürte ich Beklemmung. Ich musste da raus. Oder besser gesagt: gar nicht erst hin!

Als ich das erste Mal mit wackliger Stimme am Telefon erzählte, dass ich dieses Jahr leider nicht kommen könne, dass Weihnachten im Kreise der Lieben ohne mich kaputtgestritten werden müsse, reagierten meine Eltern und meine restliche Familie erwartungsgemäß verschnupft bis erstaunt. Was war los mit ihnen? Hatten sie alle die Jahre mit Krawall und Remmidemmi vergessen? Offenbar.
Meine Erklärung, ich würde in Berlin bleiben und am 24. Dezember in einer Suppenküche für Obdachlose arbeiten, stieß dann allerdings sowohl bei meinen Eltern als auch in meinem Freundeskreis auf Erheiterung. Darüber war ich wiederum verschnupft. Ich machte es trotzdem, alleine schon deshalb, um einen triftigen Grund zu haben, nicht in den Zug zu steigen und mit zunehmender Fahrtdauer immer deprimierter zu werden. Klingt dramatisch, war aber so.
Die Suppenküche war eine Erfahrung, die mich nachhaltig beeindruckte. Ich sah viel Armut aus nächster Nähe und Menschen, denen das Leben übel mitgespielt hatte. Solche, an denen man sonst zügig vorübergeht, maximal ein bisschen Kleingeld in einem Becher zurücklässt. Ich arbeitete von mittags bis kurz vor Mitternacht in der Suppenküche. Am Ende war ich erschöpft, und das warme, etwas selbstgefällige Gefühl durchströmte mich, etwas besonders Gutes getan zu haben, während alle anderen nur an sich dachten. Natürlich dachte ich auch nur an mich, denn ich hatte einfach einen Grund gesucht, an Weihnachten der Familie zu entkommen. Hatte meine Entscheidung damit gerechtfertigt, etwas Nützliches, gar Mildtätiges zu tun.

Doch am meisten lockten mich die beiden Tage danach. Wenn alle weg sind und Berlin mal den Rand hält. Die Stadt ist dann fast so ruhig wie am Morgen des 1. Januar, dem anderen Nerv-Fest, wenn nur noch ab und an die letzten Verwirrten ihre Restböller in die dreckige Luft jagen.
Der erste und der zweite Weihnachtsfeiertag waren paradiesisch: Niemand wollte was von mir, und ich verspürte auch nicht ständig das unangenehm summende Gefühl im Hinterkopf, etwas Wichtiges zu verpassen. Ich gammelte rum. Mampfte Kekse im Pyjama wie ein renitenter Teenager und trank schon um zwölf Uhr mittags das zweite Glas Wein. Das mit der Suppenküche ließ ich im folgenden Jahr unter den Tisch fallen. Zu meiner Familie bin ich trotzdem nicht gefahren, denn ich lag mit Fieber im Bett und dachte länger über den Zusammenhang von Krankheit und Psyche nach, denn das war ja wohl kein Zufall. Mit Schüttelfrost und Temperatur sah ich drei herrlich zwangsentspannten Tagen entgegen. Meine Eltern, die ich ein paar Monate zuvor schon besucht hatte, schickten ein Expresspaket mit Leckereien und Geschenken, und ich röchelte ein ernsthaftes „Danke“ ins Handy. Dass ich meine Mutter nie wieder sehen sollte, wusste ich da nicht. Sie starb im Sommer darauf an den Folgen einer Corona-Infektion.
Das erste Weihnachten nach ihrem Tod stand an, und ich bereitete mich darauf vor, meine liebgewonnene Festtagseinsamkeit dranzugeben. Ich rief meinen Vater an.

„Kommen? Wer? Du? Nein.“
„Aber wirst du nicht einsam sein, das erste Mal ohne Mama (und jemanden, der dich drei Tage lang bekocht)?“
„Nö, nö, ich habe schon alles organisiert.“
Fröhlich posaunte mein Vater mir sein ausgeklügeltes Festtagsprogramm entgegen, Konzert- und Restaurantbesuche inklusive, und beendete das Gespräch. Nun fühlte ich mich plötzlich einsam. Seltsam abgehängt. Doch ich dachte an das Interview, das eine Kollegin mit einem Psychologen geführt hatte. Darin ging es um Menschen, die wirklich einsam sind an Weihnachten und wohl auch sonst. Doch an diesen drei Tagen wiegt das Gefühl, alleine zu sein, niemanden zu haben, sicherlich besonders schwer.
Der Fachmann riet in dem Interview genau zu den Dingen, die mein Vater offenbar schon intuitiv in dieser für ihn sicherlich schweren Zeit getan hatte: Er hatte Weihnachten verplant und mir von drei durchgetakteten Tagen erzählt, an denen er nicht zum Nachdenken kommen würde. Meine Eltern waren 50 Jahre verheiratet, und sicherlich war das erste Weihnachten ohne meine Mutter für meinen Vater eine größere Herausforderung als für mich.
Ich blieb also alleine an Weihnachten, wie ich es die Jahre zuvor auch schon getan hatte, und das erste Mal war es nicht nur ein beglückendes Gefühl, sondern auch ein dankbares, denn ich wusste, dass ich nicht einsam war und ich jederzeit mit anderen Menschen das Fest verbringen könnte, wenn ich denn den Wunsch verspüren würde. Mal sehen, vielleicht im kommenden Jahr ...
Berlin hat einen Krisendienst und bietet Beratung an für Hilfesuchende an, auch an Weihnachten rund um die Uhr: www.berliner-krisendienst.de