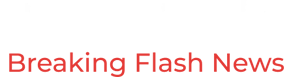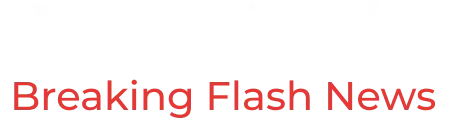Der „Tatort: Lass sie gehen“ mit Richy Müller und Felix Klare
Kann das wirklich alles sein? Dieses aschgraue, vorgezeichnete Leben, die drei Traditionen Beten, Arbeiten, Saufen, die immer selben Anekdoten der immer selben Bekannten? Die offenbar zufrieden sind mit einer Routineexistenz zwischen Betrieb, Jagd, Gaststätte, Ledercouch und großem Flachbildschirm. Letzterer dient den kleinen Fluchten in die Fiktion, wenn es doch einmal zu arg wird. Mit Peter Sloterdijk, dem Philosophen der Grauschattierungen, darf man daher insbesondere die „Tatort“-Rezeption – noch insbesonderer die sloterdijksche – als Seismograph der Gegenwartsattraktivität auffassen. Dem „Tagesspiegel“ hat der Großdenker nämlich soeben verraten, dass in seinem Leben die Wirklichkeit nur ein einziges Mal „viel poetischer“ und „interessanter“ gewesen sei als das Fiktive: in den Tagen des Mauerfalls. Als Sloterdijk dann „wieder mal einen ‚Tatort‘ oder so“ gesehen habe, habe er gemerkt: „Es ist vorbei.“ Der „Zauber der Aktualität“ war perdu, dem Reiz des Blaulichtfernsehens gewichen.

Vielleicht gilt das mit der ausgegrauten Fiktion auch für den Mittwoch der vergangenen Woche, wenngleich in der (von Sloterdijk seit Jahren herbeigefürchteten) Schreckensvariante. Inzwischen aber dürften wir uns an den Zustand der großen Implosion so weit adaptiert haben, dass uns die allsonntägliche Mordermittlung wieder in ihre Fänge lockt. Der Pleitegeier hole die Aktualität. Und tatsächlich hat der „Tatort: Lass sie gehen“ in der Regie des stets mit großem Stilwillen agierenden Andreas Kleinert – das Drehbuch schrieb Norbert Baumgarten – einnehmend viel Atmosphäre zu bieten, allerdings in der Form eines provinziellen Grauschleiers, der sich hier über ein eigentlich ziemlich schmuckes Dorf auf der Schwäbischen Alb legt (Bichishausen stand Pate).
In der Wut aber finden sie zusammen
Hanna Riedle (Mia Rainprechter) hat es nicht mehr ausgehalten in diesem Dorf: die seelenlose Neubauwohnung mit Ledercouch und Fernseher, einen bloß von der Jagd und dem Betrieb schwafelnden Verlobten (Sebastian Fritz), die Aussicht, einmal den rustikalen Gasthof der Eltern Hannes und Luise (Moritz Führmann, Julika Jenkins) zu übernehmen. „Beten und arbeiten“, so ein Leben wollte sie nicht. In die große weite Welt ist sie also gezogen, will sagen: nach Stuttgart, gleich nebenan zwar, aber mental unendlich weit fort. Sie hat eine Ausbildung als Tischlerin begonnen und mit der zu Tode beleidigten Mutter („Wenn du des machsch, dann bisch du für mich g’storbe“) kein Wort mehr gesprochen. Als Hanna dann erwürgt am Neckar aufgefunden wird, sind alle im Dorf geschockt, aber nicht wirklich verwundert: „Wenn d’Hanna hiergeblieben wär, dann wär das nicht passiert.“ Aber sie musste ja in die Stadt, wo es gefährlich sei: „wegen der ganzen Araber und so“.
TrailerTatort: Lass sie gehen
Quälend detailliert zeigt der Film, wie Vater, Mutter und Schwester (Irene Böhm) des Opfers im Schmerz versinken. Die Dorfgemeinschaft gibt wenig Halt, in der Wut aber finden sie zusammen. Schnell wird klar, dass eine ganze Reihe von Menschen Hanna die Flügel stutzen wollte. Aber sind das schon Mordmotive? Es entspinnt sich eine klassische Tätersuche, bei der Thorsten Lannert (Richy Müller), einquartiert im Gasthof der Riedles, in Hannas Heimatdorf nach Hinweisen sucht und Sebastian Bootz (Felix Klare) in Stuttgart. Doch das kriminalistische Element, die falschen Fährten und platzenden Alibis, die Aussagen von Nachbarn und Stalkern, das alles steht hier nicht im Vordergrund. Andreas Kleinert verlegt sich als Stimmungsregisseur viel stärker auf das leicht gemäldeartige Porträt eines in Traditionen gefangenen, sich nie über sich selbst hinausstreckenden Dorfes, geschmort im eigenen Sud, das vielleicht als Menetekel der neuerdings wieder kursierenden Heimatverklärungen verstanden werden soll.
Ästhetisch ist das ein Fest. Wenn die Riedles in ihrem düster spießbürgerlichen Esszimmer speisen, wenn dunkle Kruzifixe seitlich ins Bild ragen oder das ganze Dorf in der vor Jagdtrophäen starrenden Schenke zusammenkommt, dann erinnert das mehr an Michael Hanekes Eichwald in „Das weiße Band“ als an das Hochtechnologieland der „The Länd“-Kampagne. In der Stadt ermittelt sich Bootz derweil durch laute Discoclubs und erfährt von wilden Nächten Hannas. Weil sich auf dem Dorf das atavistische Auge-um-Auge-Denken erhalten hat, nimmt ein schwäbischer Albtraum seinen Lauf. Das alles wirkt als Stadt-Land-Gegensatz so albern übersteigert, dass man es nur als Spiel mit Klischees auffassen kann. Das Finale ereignet sich einigermaßen unmotiviert im spektakulären Monolithen der Stuttgarter Stadtbibliothek, was noch einmal überdeutlich macht, dass die auf dem Dorf zur Hure Schwabylon dämonisierte Hauptstadt in Wahrheit ein Ort des Wissens ist.
So lässt sich „Lass sie gehen“ zwischen zwei Sätzen verorten, zwischen „Sie hat doch hier alles g’habt“, wie ihr Ex-Verlobter klagt, und Sloterdijks „Es ist vorbei“. Die Hoffnung auf die große Freiheit in der Stadt, so die Botschaft des Films, mag selbst eine Fiktion sein, eine tödliche manchmal sogar, aber doch poetischer, aktueller, zauberhafter als das enge Dorfleben. Inhaltlich ist das alles freilich ein großer Quatsch. Wenngleich viele ländliche Kommunen sich abgehängt fühlen, weil Supermärkte und Bankfilialen geschlossen haben, ist der wichtigste Trend auch in Baden-Württemberg seit Jahren, dass junge Menschen und Familien aus den überteuerten Städten wieder raus aufs Land ziehen. Was zu ganz anderen Problemen führen mag.
Der Tatort: Lass sie gehen läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.