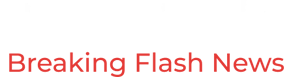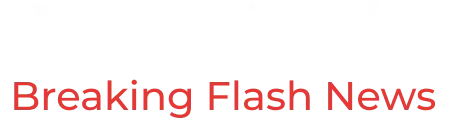Grüne: Robert Habeck greift nach der Macht – das könnte die Partei ...
Deutschlands Vizekanzler galt als einer, dem es nicht um die Karriere, sondern wirklich um die Sache geht. Das war schon immer ein Märchen. Spätestens jetzt glaubt es keiner mehr.

M. Popow / Imago
Sie lesen einen Auszug aus dem werktäglichen Newsletter «Der andere Blick», heute von Susanne Gaschke, Autorin der NZZ Deutschland. Abonnieren Sie den Newsletter kostenlos. Nicht in Deutschland wohnhaft? Hier profitieren.
Einzig die deutschen Grünen ziehen bis jetzt personelle Konsequenzen aus ihrem Debakel bei den jüngsten Wahlen in Europa und in Ostdeutschland. Dabei hätten alle drei Parteien, die in Berlin die sogenannte Ampelkoalition bilden, Grund, darüber nachzudenken, was sie falsch machen. Denn dieses Bündnis aus Grünen, SPD und FDP hat es innert kurzer Zeit geschafft, die unbeliebteste Regierung der bundesrepublikanischen Geschichte zu stellen.
Nur drei Prozent der deutschen Bevölkerung wünschen sich nach einer aktuellen repräsentativen Umfrage, dass die drei Partner auch nach der Bundestagswahl in einem Jahr wieder gemeinsam regieren. Der sozialdemokratische Bundeskanzler Olaf Scholz kommt auf spärlichste Beliebtheitswerte – und seine ehemalige Volkspartei muss sich mittlerweile selbst dazu gratulieren, wenn ihr mit sechs oder sieben Prozent gerade eben noch der Einzug in ostdeutsche Landtage gelingt.
Die FDP befindet sich in existenzieller Not. Sie flog nun aus drei Landtagen (mit Ergebnissen leicht über oder unter einem Prozent) und rangiert auch in bundesweiten Umfragen unterhalb der in Deutschland entscheidenden Fünf-Prozent-Marke. Ihre Koalitionspartner schelten sie vor allem wegen ihres Festhaltens an der verfassungsmässig festgeschriebenen Schuldenobergrenze. Und ihre hauptsächlich in der gutsituierten Mittelschicht beheimateten Wähler wenden sich mit offensichtlichem Grausen von der grün geprägten Wirtschafts- und vor allem der Gesellschaftspolitik ab, die die FDP mitträgt.
Angst vor noch schlimmeren WahlergebnissenDoch die Angst vor noch schlimmeren Wahlergebnissen und dem Verlust von Posten, Büros und Mitarbeitern hält FDP und SPD weiter in einer Regierung, die beiden nicht guttut. Nur die Grünen versuchen die Flucht nach vorn. Sie wurden in den jüngsten Landtagswahlen ebenfalls abgestraft und im Bund (nach deutlich besseren Jahren) wieder auf Umfragewerte zurückgeworfen, die sich mit zehn Prozent auf ihre Kernklientel beschränken.
Auf die Regierungsbeteiligung wollen zwar auch die Grünen nicht verzichten. Doch diese Woche kündigte ihr gesamter Bundesvorstand an, sich auf dem bevorstehenden Parteitag im November nicht erneut zur Wahl zu stellen. Die beiden Vorsitzenden Ricarda Land und Omid Nouripour erklärten, «in der tiefsten Krise seit einer Dekade» Platz machen zu wollen für eine «strategische Neuausrichtung».
Die Grünen wären nicht die Grünen, wenn sie aus diesem Manöver nicht sofort moralische Überlegenheit gegenüber der Konkurrenz ableiten würden. Ihr Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck wurde in mehreren Interviews geradezu lyrisch, als er von seiner Partei sprach, «in der die Menschen bereit sind, ganz ungewöhnliche Schritte zu gehen».
«Ich werde das nicht vergessen»Er lobte Langs und Nouripours Opferbereitschaft, ihre «Stärke und Weitsicht», ihren «Dienst» an der Sache und an den Grünen – ja, er steigerte sich sogar zu der Formulierung, ihr Rücktritt sei ein «Geschenk» an die Partei. Dafür hätten die beiden «persönliche Wünsche, Pläne und Hoffnungen» zurückgestellt: «Ich werde das nicht vergessen», sagte Habeck im Fernsehen, als sei er schon der Patron, der in Zukunft grosszügig die Belohnungen verteilt.
Vom eigenen Pathos war er dabei sichtlich ergriffen, vermied es aber penetrant, auf die Frage des Moderators zu antworten, was die zwei Parteivorsitzenden denn konkret falsch gemacht hätten.
Pikant an dem Vorgang ist, dass Lang und Nouripour zu ihrer Opferbereitschaft wohl massiv motiviert werden mussten – so wird es jedenfalls in Berliner Grünen-Kreisen erzählt. Dem 55-jährigen Habeck, der nach eigener Einschätzung 2021 der bessere grüne Kanzlerkandidat gewesen wäre als seine ehrgeizige Parteifreundin Annalena Baerbock, lag offenbar viel daran, vor dem Grünen-Parteitag Druck vom Kessel zu nehmen.
Dem Vernehmen nach zeigte sich schon an den eingereichten Anträgen für den Parteitag, dass es an der Basis brodelt. Und dass zu viele Grüne den aus Habecks Sicht fatalen Schluss ziehen könnten, es sei die Regierungspolitik, die der Partei bei ihren Wählern schade. Der nun ebenfalls angekündigte Abgang und gleichzeitige Parteiaustritt des Vorstands der grünen Jugendorganisation weist ebenfalls in diese Richtung. Ihnen passt die ganze Politik nicht mehr.
Ein Bauernopfer musste herFür Kompromisse in der Regierung steht der Vizekanzler allerdings wie kein Zweiter: Eine Rebellion auf dem Parteitag hätte seine Inthronisierung als Kanzlerkandidat stören oder womöglich gar verhindern können. Das wollte Habeck offenbar auf keinen Fall noch einmal riskieren. Er scheint von seiner persönlichen Eignung für das Spitzenamt in der Regierung inzwischen annähernd so überzeugt zu sein wie Olaf Scholz von der seinen.
Ein Bauernopfer musste also her. Und offenbar gelang es, Nouripour und Lang davon zu überzeugen, dass sie dieses Opfer seien. Habeck hat für solche Lagen im Verlauf seines politischen Lebens eine gewisse Überzeugungskraft entwickelt: Er versteht es ausgezeichnet, Konkurrenten im vertraulichen Gespräch zu der Einsicht zu bewegen, dass es jetzt wirklich besser für alle Beteiligten sei, wenn er, also Habeck, das mal mache. Nur an Annalena Baerbock hatte er sich in dieser Hinsicht die Zähne ausgebissen.
Es wirkte recht heuchlerisch, wie Habeck von den scheidenden Vorsitzenden schwärmte, die gerade deshalb so gute Vorsitzende gewesen seien, weil sie nun gingen. Dass er – der stets gern den Eindruck kultiviert, er sei in politische Verantwortung immer nur irgendwie hineingestolpert – für alle erkennbar nun zu solchen Mitteln greift, zeigt, wie sehr der Wille zur Macht einen Menschen verändert. Habecks Beteuerung, auch er werde sich der Kritik auf dem Parteitag stellen und sich in «geheimer Abstimmung» mit einem «ehrlichen» Ergebnis auf den Schild heben lassen, sollte vielleicht nach Demut klingen, es wirkte aber obrigkeitlich.
«Regulierungswut und ihrer Technikfeindlichkeit»Ob sich Habecks ostentatives Machtbewusstsein für die Grünen lohnt, wird sich zeigen. Während die von ihnen getragene Regierung der grünen Basis entschieden zu «rechts» ist und der Vizekanzler und seine Leute ihr zu viele Kompromisse machen, ist der Rest der Republik eher irritiert über die grüne Unbeirrbarkeit. Die Grünen haben der Berliner Koalition so sehr ihren Stempel aufgedrückt, dass Sozialdemokraten und FDP sich wahrscheinlich jahrelang davon werden erholen müssen.
Für die meisten Wähler von CDU und CSU sind die Grünen zum Feindbild geworden. Der CSU-Chef Markus Söder hat sich in dieser Frage deshalb schon eindeutig positioniert und eine Zusammenarbeit kategorisch ausgeschlossen. Und auch der CDU-Parteivorsitzende und frisch gekürte Kanzlerkandidat der Union Friedrich Merz äusserte sich jüngst skeptisch: Es gebe keine Partei im «demokratischen Spektrum der breiten Mitte», die im Augenblick bei Unions-Mitgliedern und -Anhängern so schlecht ankomme, sagte er in einem Interview: «Die Grünen lösen das aus mit ihrer Art der Politik, mit ihrer ständigen Bevormundung, mit ihrer Regulierungswut und ihrer Technikfeindlichkeit.» Das könne sich allenfalls noch einmal ändern, wenn die Grünen sich änderten.
Härter kann es Merz aus Rücksicht auf die mit schwarz-grüner Mehrheit regierenden CDU-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen und Daniel Günther in Schleswig-Holstein nicht formulieren.
Der hohe Ton der GrünenDoch selbst diese Erbwalter der Merkel-CDU merken langsam, dass die dogmatische Klima- und Flüchtlingspolitik der Grünen bei der eigenen Klientel auf heftige Ablehnung stösst. Die meisten CDU-Anhänger wollen einfach nicht mehr für die Unionsparteien stimmen, wenn das bedeutet, dass sie grüne Regierungsbeteiligungen in Kauf nehmen müssen. Denn dank ihrer moralisierenden Attitüde gelingt es den Grünen immer wieder, als kleinere Partner in einer Koalition zu dominieren – zum Schaden ihrer Partner.
Die derzeitige «Wir haben verstanden»-Inszenierung der Grünen dürfte also in kommenden Wahlen nicht verfangen, solange der nervende hohe Ton überlegener Einsicht und Moral prägend für den Auftritt der Partei bleibt. Habeck selbst beherrscht diesen Ton, der innerparteilich sehr gut ankommt, perfekt.
Wenn aber Union und SPD dauerhaft auf Abstand gingen, läge darin eine grosse Gefahr für die kleine Partei – und eine Volkspartei sind die Grünen trotz allen Bemühungen und allen temporären Umfragehochs nie geworden. Sie könnten dann ihre Funktion für die parlamentarische Mehrheitsbildung verlieren. Das Risiko funktionaler Überflüssigkeit liess sich jüngst bei der FDP in Ostdeutschland beobachten.